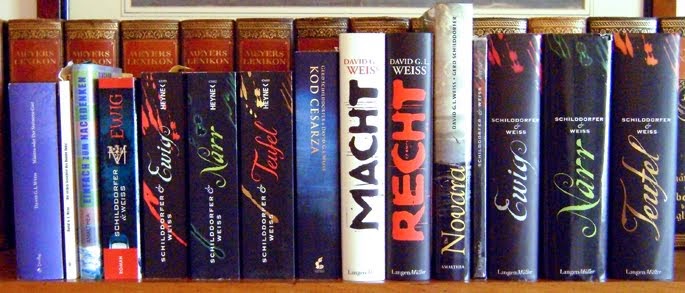Teil 38: Hexenjagd
Das so genannte Kommunikations- und Informationszeitalter
lässt mich sprachlos zurück. In all dem babylonischen Stimmenwirrwarr – Oder
ist es ein regulierter und begradigter Strom? – weiß ich schön langsam nicht
mehr, was ich sagen bzw. schreiben soll. Oder ob ich überhaupt noch Worte
setzen möchte? Wo doch schon alles gesagt ist und gewusst wird. Ist es
sinnvoll, dem anhaltenden Schwirren weiteres Gebrumm hinzuzufügen?
Mich überkommen große Zweifel, dass mich mein Schwarm
versteht. Nicht etwa weil ich so schlau, und die andern so dumm sind. (Dieser
Gedanke erscheint dieser Tage vielen am wahrscheinlichsten und darum auch am
glaubwürdigsten. Gerade weil das so ist, und der Einfallsreichtum der
Feindseligen erfahrungsgemäß beschränkt ist, wird dieser vielfältige
Trugschluss oft und gerne dem Gegenüber zum Vorwurf gemacht oder zur Intrige und
üblen Nachrede genutzt.) Aber nein, sondern weil ich erschüttert und verwirrt
bin, ob ich jemals wieder den richtigen Ton treffen werde, dass meine Stimme in
dem Kanon da draußen klar und verständlich gehört werden kann. Kanon, weil ich
deutlich verschiedene Tonlagen denselben Text zeitversetzt und unter
unterschiedlichen Vorzeichen absingen höre.
Das liegt natürlich auch daran, dass ich eine Existenz
führe, die mich mit einem Bein in der Neuen und mit dem andern in der Alten
Welt stehen lässt. In der Grätsche wie die historisch falsche aber
eindrückliche Vorstellung des Kolosses von Rhodos über der Hafeneinfahrt der
griechischen Insel. Oder wie der venezianische Markuslöwe, der mit seinen
Vorderpfoten auf dem Festland und mit den Hinterpfoten auf dem Meer steht. Zu
allem Überfluss hat dieses Wappentier auch noch Flügel, so dass überhaupt nicht
mehr klar ersichtlich ist, welches der drei sein Element ist, Wasser, Erde oder
Luft. Armes verwirrtes Katzentier. Woher soll ich dann wissen, welche inzwischen
meine geistige Heimat ist, Europa oder die USA?
Meine „speziellen Bedürfnisse“ haben meine Sichtweise noch
weiter verschoben, sie haben mich noch weiter aus dem Mittelwert gerückt. Hier
wie dort auch. Andererseits haben sie meinen Blick geschärft. Es wäre verleugnend,
wenn ich die in mir wachsende Enttäuschung übersehen oder verschweigen würde.
Könnten wir, d.h. die Bewohner der so genannten westlichen Welt, alle Vorzüge
und guten Eigenschaften der Vereinigten Staaten und Europas tatsächlich zu
einer Kultur vereinen, wir lebten in der perfekten Welt. Stattdessen werden
Argumentationslinien und Gedankenmuster übernommen, die in der sich über
Jahrhunderte entwickelten geistigen und wirtschaftlichen Umwelt des jeweils
anderen Kontinents keinen Lebensraum hätten. Gäbe es da nicht eine ebenfalls
geschichtlich begründete intellektuelle und emotionale Leere, die diese
endemischen Geistesunkräuter als ökologische Nischen ausnutzen könnten. Ich
lebe im Heiligen Land der First Church of Income, und es ist bei Gott kein
Garten Eden. Und es war nicht die Schlange, die den Hain verwüstete, Adam und
Eva haben sich selbst in die Rabatten gekackt.
Ich habe auf die harte Tour gelernt, durch langes
vergebliches Warten, dass das, was viele Reisende für Freundlichkeit halten,
bloße Scharade ist. Der angekündigte Rückruf, ein leeres Versprechen. Und das
mit großer Geste gegebene Versprechen, sich um etwas zu kümmern, der Verheißung
entspricht, dass das Christkind die Geschenke bringt. Die Verantwortung für das
eigene Tun und Lassen gilt nur während der Bürozeiten. Und im Job macht ja jede
und jeder einmal einen Fehler. An dieser Stelle verständiges Zuzwinkern und
sich den Ellenbogen verschmitzt grinsend in die Seite stupsen. Schön wäre es,
gälte dasselbe auch für die Konsequenzen. Herrlich, wenn alle Menschen ein
bedingungsloses Grundeinkommen und Kranken- und Sozialversicherung hätten,
sobald in den Regierungsgebäuden die Stechuhr erklingt und das Licht ausgeht. Entweder
man macht und hilft sich selbst, oder alles bleibt ungetan. So kommt es, dass
man ständig allem und jedem hinterher ist. Wie ein Hund, der die vorbeifahrenden
Autos jagt. Bleibt ein Köter dabei auf der Strecke, drüber springen und weiterhetzen.
Ständig mit Musik im Ohr, dem Soundtrack des Lebens, kommt einem diese
aufgezwungene und atemlose Existenz auch noch interessant vor. Weil der liebe
Gott das so wollte, der allmächtige Dollar oder Euro.
Einige Ereignisse der letzten Zeit haben meine Wahrnehmungen
und Überzeugungen auf harte Proben gestellt. Aus meiner isolierten Lage lebe
ich weltabgewandt, der Gesellschaft (oder den Gesellschaften, der europäischen
und amerikanischen) stets als Zuschauer zugewandt. Wie ein berühmter
Schriftsteller, ich glaube, es war Frederic Morton, in etwa formuliert hat: Ich
bin der Mann, der im Ballsaal tanzt und sich dabei durch das Schlüsselloch
zusieht. Ich weiß, vielen ergeht es so wie mir. Und aus Angst, das Falsche zu
sagen, schweigen einige für immer. Wie ein „wohlerzogenes“ Kind, das sich aus
Angst vor der Reaktion der Eltern auf seine Bedürfnisse selbst verleugnet. Weil
sie oder er gefallen will. Oder anders ausgedrückt: Kein Missfallen erregen und
keine unberechenbare Reaktion heraufbeschwören möchte. Und das Schweigen, das
Mundtotsein, wird nicht als Schüchternheit erkannt, sondern als Arroganz
gedeutet. Das Verhalten als verrückt. Man möchte es zurecht rücken. Und geht
das nicht, am liebsten ganz aus den Augen verlieren.
Anständig und menschlich ist man naturgemäß immer selbst. Die
Entmenschlichung des Gegners ist ein seit jeher bewährtes Kampfmittel. Und so
kommt es dann, dass der Karikaturist einer Propagandazeitung einer
nationalsozialistischen Arbeiterpartei und der Werbemittelhersteller einer
linken städtischen Bürgerpartei unabhängig voneinander und zu verschiedenen
Zeiten auf dasselbe Sujet kommen, den politischen Gegner, das Objekt ihres (noch
nicht einmal geleugneten) Hasses darzustellen oder besser gesagt zu
diffamieren. Aber auch hier gilt die sprichwörtliche Ansicht, dass wenn zwei
das Gleiche tun, es noch lange nicht dasselbe ist. Genannte Ursachen sind Unwissenheit,
Naivität und fehlende Ressourcen. Aber in einer Zeit, die mehr als jemals zuvor
an Programmierung, Genetik und damit wieder an Prädestination glaubt, erscheint
auch dieses Dogma, genau wie diese Ausreden, mehr und mehr hinterfragwürdig. Schon
im Bürgerlichen Gesetzbuch schützt Unwissenheit nicht vor Strafe. Auffällig ist
auch, dass beim Hinweisen auf gewisse, ganz ähnlich geartete Textstellen in einschlägigen
Liederbüchern der politischen Antipode, beinahe wortgleich dieselben Rechtfertigungen
von den dort Beschuldigten ins Feld geführt werden: Unwissenheit, Naivität und
mangelnde Ressourcen. Aber wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht
dasselbe! Tatsächlich? Allen, fast identischen Ausdrücken muss schließlich
derselbe Quellcode, d.h.: eine bestimmte Weltsicht bzw. Menschenwahrnehmung,
zugrunde liegen, oder jedenfalls ein nur wenig abweichender. Wovon das Herz
voll ist, davon geht der Mund über. Oder: An ihren Früchten wirst Du sie
erkennen!
In Yale beginnt das neue Semester, und das behütete und
aufwendig gehegte akademische Spalierobst kehrt in seine Gärten zurück. Aber auch
der fruchtbare Boden dieser besonderen Gated Community wurde zwischenzeitlich
von heftigen, unerwarteten Erdstößen erschüttert und aufgewühlt. Ein mittleres
Erdbeben breitete sich aus New York City aus, dessen Ausläufer bis nach New
Haven und weit darüber hinaus zu spüren waren. Und es waren und sind nicht die
süßesten Früchte, die diese Umstände an den Trag bringen. Weder an den frischen
grünen Trieben, noch an den tiefer verwurzelten Hölzern.
Am Beginn standen Polizeinotrufe weißer Bürgerrechtlerinnen
und anderer Studenten wegen afroamerikanischer oder farbiger Kommilitonen.
Diese hatten sich solcher Unglaublichkeiten schuldig gemacht wie einem
Nickerchen in einem der Aufenthaltsräume eines Dormitorys, oder dem Fragen nach
dem Weg in einer der weitläufigen Bibliotheken. Die Logik der Anrufer: Ist dein
Gesicht im Farbton dunkler als ein reifer Cheddar-Käse, dann bist du eine collegefremde,
weil bildungsferne Person. Am Ende stand ein Culture Clash der interkontinentalen
Art für Juliane und mich.
Semesterende und -beginn bedeuten Kommen und Gehen, Umzüge
allerorts. Unsere bisherigen Nachbarn zogen aus, neue besiedelten unseres und
die Nachbarhäuser. So weit so gut. Aber nicht nur verlangt das Leben in den USA
scheinbar stets nach einem Soundtrack, sondern dieser muss offenbar auch das
kulturelle Erbe widergeben. Und Cultural Heritage, darüber verfügen nur
Minderheiten und Randgruppen. Die etablierte Mehrheit lebt geschichtslos. Das
ist im Wesentlichen aber bedeutungslos, denn der Krach war ganz gegenwärtig.
Jeder Musik kann man sich nicht entziehen, und überschreitet sie ohne dazu eingeladen
zu sein eine gewisse Lautstärke, dann wird sie als Lärm empfunden. Egal ob es
sich dabei um eine gute alte europäische Sonate in F-Dur, den üblichen kommerziellen
westlichen Globalisierungsbrei oder um südamerikanische Klänge handelt.
Mit unseren Latino-Nachbarn konnten wir uns schnell
verständigen. Weder die Musikuntermalung der Basteleien am Harley
Davidson-Motorrad und der Gartenarbeit (wenigstens wurde sie erledigt, und
endlich die Müllhalden im Hinterhof entsorgt), noch ein Kindergeburtstag im Garten,
der bis Mitternacht dauerte, störte uns. Trotz erster Verwirrung erschien das
Konzept, die Kinder auch bis spätnachts wach zu halten, am nächsten Morgen als überaus
sinnvoll. Die lieben Kleinen der Partygeber waren nämlich nicht schon
frühmorgens wach und wollten unterhalten sein und spielen, sondern waren genauso
erschöpft und müde wie die Erwachsenen. Der Familienvater konnte am Vormittag
schon ungestört mit dem Aufräumen beginnen, was er gewissenhaft tat. Er kehrte
sogar den Gehsteig. Nur, dass er dabei natürlich Musikuntermalung brauchte. Sollte
so sein. So sauber war es um dieses Haus noch nie. Aber als der Radio alleine
im Garten stand und lauthals aus den Boxen plärrte, schaute ich aus dem
Küchenfenster und sah meine Gattin über die Wiese in den Nachbarsgarten
stapfen. Nach einem kurzen höflichen aber bestimmten Gespräch war die Sache
erledigt. Von dieser Seite unseres Hauses kam nie wieder ein Anlass zur Klage
oder Beschwerde. Und Musik zu vernünftigen Tages- und Nachtzeiten ist keiner.
Ganz anders dagegen schaute es lange Zeit nach der anderen
Seite aus. Dort zog eine Liebhaberin der gepflegten Rap Musik ein. In meinen
Ohren Sprechgesang mit Werkstattgeräuschen unterlegt. Vom Text verstand ich immer
entweder abwechselnd: Bitch, Dick, Money oder Fuck. Besonders fein war ein
Refrain, der sich aufgrund seiner hämmernden Wiederholung unauslöschlich bei
mir einprägte. Er lautete einmal (und ich entschuldige mich): „Suck the cock! Suck
the sugar cock!“ Und danach: „Shoot the Cop! Shoot the Cop!” Allerliebst! Vor
allem um Zwei Uhr morgens. Und so laut, dass du glaubst die Boxen stehen nicht
im Nachbarhaus, sondern neben deinem Bett. Als dann auch noch das Smartphone
klingelte, die liebe Nachbarin abhob, sich lauthals unterhielt, dazu begeistert
kreischte und auch noch den Lautsprecher des Telefons anmachte, wurde meine
Frau ungemütlich. Zunächst bat Juliane durch das geöffnete Fenster um Ruhe,
britisch und gesittet. Aber als hätte sie nur darauf gewartet, antwortete
unsere Nachbarin unmittelbar und wie aus der Pistole geschossen: „Shut up,
bitch!“ Sie wollte ihr Gespräch auch gleich unverändert und im selben Habitus
fortsetzen. Aber sie hatte nicht damit gerechnet, dass europäische Aggression
sich nicht auf bloßes Posieren beschränkte. Kurz gesagt, ich habe meine Frau
noch nie so entschlossen gehört. Juliane erwiderte die ihr entgegengebrachte
Freundlichkeit mit einer Deutlichkeit, die keinen Zweifel offen ließ. Und für
diese Nacht war dann auch Ruhe. Aber das Ausloten der Belastbarkeit der anderen
Mieter ringsum ging weiter.
Des Minenfeldes zu meinen Füßen bewusst, erkundigte ich mich
bei einer Bekannten mit einschlägiger beruflicher Erfahrung, was ich in dieser Situation
unternehmen könnte. Ich wurde glaubhaft gewarnt, dass Juliane als weiße und
blonde Frau nicht hinüber gehen sollte, um das Gespräch zu suchen. Das, so
versicherte mir meine Gesprächspartnerin, funktionierte bei Spanischsprachigen,
aber nicht in diesem Fall. Zu gefährlich. Zu viele Ressentiments. Welche denn,
fragte ich mich, aber nahm den Rat an. Wir Europäer hatten mit der
US-amerikanischen Sklaverei nichts am Hut. Leibeigenschaft und damit de facto
auch die Sklaverei waren seit dem 18. Jahrhundert dank Joseph II. in Österreich
und dem Heiligen Römischen Reich verboten, also auch in Sachsen. Ab Elf Uhr
nachts, riet man mir weiter, könnten wir die Polizei rufen. Diese Leute (!),
sagte meine Bekannte, fürchteten sich vor der Polizei. Mit dem Nachsatz: Wir
alle fürchten uns vor der Polizei.
Na toll! Rief ich beim nächsten Mal die Polizei wegen „dieser
Leute“, bedeutete das doch automatisch, zurück zum Start. Also zurück zum Rassismus-Skandal.
Und ich wurde das Gefühl nicht los, dass das auch durchaus so beabsichtigt bzw.
überlegt war. Keiner der Nachbarn traute sich, wegen der Lärmbelästigung die
Cops zu rufen. Aus Angst, dafür an den Pranger gestellt zu werden.
Inzwischen ist jedoch Ruhe. Und ich frage mich, ob das
Experiment beendet wurde, oder ob es ein Mitbewohner oder eine andere Mieterin
geschafft hat, das Problem auf andere Weise in den Griff zu bekommen. Das
Resultat ist jedenfalls dasselbe, ein ruhiges und friedliches Zusammenleben ist
wieder möglich. Dass besagte Nachbarin auch nach wiederholtem Hinweis durch die
Eigentümer immer noch in der Garage unserer (weißen) Vermieter parkt, ist mir
aber inzwischen egal. Ich habe keine Lust, weiter in dieser Angelegenheit den
Hausmeister oder den ABV zu mimen. Den Skandal soll sich bitte jemand anderer
aufhalsen. Das System funktioniert!
Fortsetzung folgt…