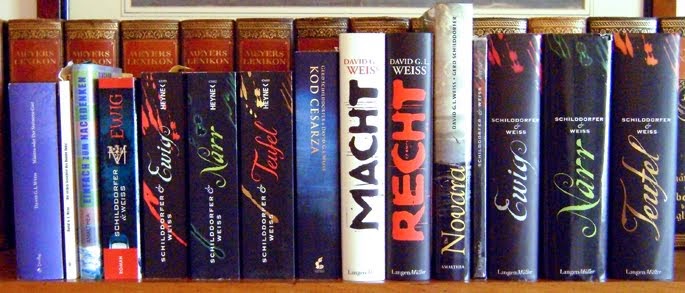Teil 44: Fazit
Den meisten, die wie ich im sogenannten
Westen (Wien liegt östlicher als Prag, Leipzig und Dresden) des
Nachkriegseuropas gegen Ende des Kalten Krieges und der Sowjetunion geboren worden
und aufgewachsen sind, wurden die Vereinigten Staaten als die Neue Welt der
Verheißung vermittelt. Als Schlaraffenland, wo der Tellerwäscher zum Millionär werden konnte. John Wayne hatte im
Strahlenkranz der Hollywoodstudioscheinwerfer eigenhändig den Wilden Westen
erobert und ganz alleine den Zweiten Weltkrieg gewonnen. An beiden Ozeanen. Spiel-
und Dokumentarfilme sowie TV-serien vermittelten Gläubigen zu allen Seiten des
Atlantiks die Frohbotschaft der First Church of Income. Und das Licht der
Freiheit, in dem sich die US-Amerikaner am liebsten selbst sahen und gesehen
werden wollten. Bis heute. Der Eiserne Vorhang stellte in dieser Stimmungslage
bekanntermaßen die Wetterscheide dar. Aber weder real existierender Sozialismus
noch Reaganomics schufen das Paradies auf Erden. Das USA-Bild meiner Kindheit
und Teenagerjahre, geprägt vom Kalten Krieg, Kapitalismus und
Unterhaltungsindustrie, wurde für mich in den vergangenen zwei Jahren nicht
bloß angeknackst, es ging völlig zu Bruch, nachdem es im Alltag alle
Glaubwürdigkeit eingebüßt und aus dem Rahmen gefallen war. Besonders das
historische und politische Motto der USA „E pluribus unum!“ hing in Fransen. Da
es in meinen Augen weder in der Vergangenheit, noch in der Gegenwart der
Vereinigten Staaten jemals so etwas wie Einschließlichkeit und Toleranz gegeben
hat. Zu tief waren seit jeher die politischen und sozialen Grabenbrüche. Zu
ausgeprägt erwies sich der Alltagsrassismus. Die heutigen USA unter Präsident Donald
Trump präsentierten sich mir mitnichten als Paradies, aber als Fegefeuer. Für viel
zu viele wurden sie zur Hölle auf Erden, wenige konnten unter besonders
günstigen Umständen ihre Seligkeit erlangen, die Mehrheit büßte hier ihre
Sünden ab.
Viele Klischees über die USA und
ihre Bewohner hielten der Überprüfung durch das Zusammenleben nicht stand.
Zuallererst, die so genannten „Amerikaner“, „Amis“ oder wie auch immer jemand
die vielfältigen Bürgerinnen und Bewohner der US-Staaten zusammenfassen möchte,
waren kein Stück dümmer oder ungebildeter als alle anderen
Durchschnittsbevölkerungen der restlichen Welt. Vieles, was mir während meines
Auslandsaufenthalts von österreichischen Medien als unlösbare innenpolitische
Debatten daheim dargestellt worden waren, bedeutete in den USA überhaupt kein
Problem: Berittene Polizei, Rechtsabbiegen bei Rot und elektronische
Abbiegeassistenten in Fahrzeugen. Um hier nur drei Paradebeispiele zu nennen. Wahr
ist hingegen, dass im Vergleich zu Europa sehr viel weniger Menschen Zugang zu Bildung,
Wohlstand und Medizin haben.
Die US-amerikanische Gesellschaft
präsentierte sich mir keineswegs als frei und sozial durchlässig. Im Gegenteil,
ich erlebte eine feudale oder oligarchische Gesellschaft, in der Geburt und „Rasse“
und keineswegs Begabung und Leistung die Klassen- bzw. Milieuzugehörigkeit
bestimmte. Und zwar unwiderruflich und auf Lebenszeit. „Entitlement“/
„Anspruch“ war daher in etlichen Gesprächen und Diskussionen über
gesellschaftliche Probleme ein Thema. Insbesondere, wenn das durch Elternhaus, Lehrerinnen
und Ausbilder anerzogene Selbstverständnis der Yale-Studierenden in ganz
normalen Alltagssituationen auf die Wirklichkeit traf, z.B. beim Überqueren
einer Straße als Fußgänger. Nein, Autofahrer bremsten nicht sofort, sobald eine
oder einer von ihnen den Fuß auf die Fahrbahn setzte. Doch wie einige selbst
zugaben, bis zu ihrem Studienabschluss hatte noch niemand jemals „Nein“ zu
ihnen gesagt.
Um eine faszinierende Facette
reicher ist die Diskussion um das „Entitlement“ durch die Verurteilung der
Hochstaplerin Anna Sorokin in New York. Die in die USA emigrierte Deutschrussin
wurde wegen Diebstahls schuldig gesprochen, das volle Strafmaß wird im Mai 2019
bekannt gegeben. Sorokin war es gelungen, sich mittels selbstbewusstem und
entsprechendem Auftreten in die so genannten wohlhabenden Kreise New York Citys
einzuschleusen. Die junge Frau aus einfachen Verhältnissen, Sorokin war die
Tochter eines Lastwagenfahrers, gab sich erfolgreich als „reiche Erbin“ aus,
ermöglichte sich ein Luxusleben auf Pump und bekam von Banken Unsummen an
Krediten für ihre Geschäftsideen genehmigt. Wie es aussieht, alles Lüge. Sie
hatte gelernt, mit den Wölfen zu heulen. Wen wundert es, dass sich der
Streamingdienst Netflix und der Sender HBO bereits für eine Verfilmung ihrer
Lebensgeschichte interessierten.
Diesen besonderen Anspruch,
dieses Geburtsrecht, behauptete allerdings die gesamte Nation für sich. Bis
heute und seit ihrer Gründung. So konnte der 45. US-Präsident Donald Trump in
seiner 2019 State of the Union Address am
5. Februar vor dem 116. United States
Congress, vor 46,8 Millionen Zusehern auf 12 der wichtigsten nationalen
TV-Sender und vor weiteren rund 15 Millionen online unwidersprochen erklären: „Together, we represent the most
extraordinary Nation in all of history.“ („Gemeinsam repräsentieren wir die außergewöhnlichste Nation der ganzen
Geschichte.“)
Weltgeschichtlich war diese
Aussage naturgemäß Quatsch. Objektiv betrachtet war sie sogar lächerlich.
Irgendwo im Jenseits hörte man die Pharaonen Ägyptens, die Konsuln und Cäsaren Roms,
die Moguln Indiens und die Söhne des Himmels Chinas zu der unfreiwilligen
Pointe lachen.
„Sie“, die US-Amerikaner, waren
allerdings so zahlreich, dass ihr Wort innerhalb der gegenwärtigen kapitalistischen
Weltordnung ungleich mehr ins Gewicht fiel als die Äußerungen aller anderen
Global Player. Und sogar bekennenden regierungskritischen und ausgewiesen
liberalen Intellektuellen konnte ich ein unbewusstes Lächeln ins Gesicht
zaubern, wenn ich darauf angesprochen hinwies, dass die österreichische Kleinstaaterei
zwar in gehäuften Einzelfällen unappetitlich wurde, aber gegen die
Schelmenstücke des US-Präsidenten unwichtig war. Da Donald Trump anders als Bundeskanzler
Sebastian Kurz und die FPÖ welthistorische und globale Tragweite und Bedeutung
besaß. Stolz hieß die Canaille! Auch wenn meine Gesprächspartner sich und
anderen niemals eingestehen würden, dass sie patriotische Gefühle hegten. Und
wer jetzt beim Lesen, dass österreichische Innenpolitik weltpolitisch
unbedeutend war, eine kleine Ärger Wallung verspürt hat, dito.
Aufgrund der gewaltigen
Ausdehnung ihrer Nation, eigentlich ein inzwischen als Nation begriffener
Staatenbund, fiel es leicht, die USA mit der Welt an sich zu verwechseln. Des
Frosches Horizont war bekanntlich immer und überall der Brunnenrand, und Uncle
Sam´s Brunnenkranz war gewaltig. Im Osten und Westen jeweils ein Ozean,
Atlantik und Pazifik. Die Menschen konnten zum Schifahren nach Colorado oder
Vermont, zum Schwimmen nach Florida oder Kalifornien, an den Strand einer
exotischen Inselwelt nach Hawaii, in die Karibik nach Puerto Rico, ins Ewige
Eis nach Alaska, in die Wüste nach Nevada, zum Viehtrieb nach Texas und in das
Reich ihrer Träume nach Disneyland oder Hollywood. Ein Flugzeug flog hier
etliche Stunden in eine Himmelsrichtung, durchquerte mehrere Klima- und
Zeitzonen und landete danach immer noch im Inland. Ein Mensch konnte sein Leben
lang niemals sein Geburtsland verlassen haben und trotzdem zigtausende Kilometer
bzw. Meilen gereist sein, um in unterschiedlichsten Gesellschaften gelebt zu haben.
In einem politischen System, das eine einheitliche Währung und exklusive,
nicht-metrische Maßeinheiten verwendete. Wie sollte ein Mensch unter einfachen
oder mittelständischen Lebensumständen da zu der Einsicht kommen, dass es so,
wie sie oder er es gewohnt ist, nicht auch auf dem ganzen Erdenrund zugeht?
Nicht überall dasselbe gegessen, gedacht und gemacht wird? Es sei denn, sie
oder er traten der US-Army bei und wurden im Ausland stationiert. Entgegen
landläufiger Vorurteile waren es Veteranen, die überdurchschnittlich oft einen
gemäßigten, weltoffenen und klimabewussten Blickwinkel vertraten. Aus alldem
ergab sich ein Krähwinkel globalen Ausmaßes. Ein Planet Krähwinkel sozusagen.
Viele im globalen Dorf quäkten
„Freiheit!“ und schlossen sich dem Selbstbild der USA an, weil sie aus den
eingangs beschriebenen Kanälen nichts anderes kannten. Ohne zu begreifen, dass
dieser Freiheitsbegriff auf den schlimmsten gemeinsamen Nenner gebracht nichts
anderes bedeutete als Abbau des Sozialstaates, Zensur, Rassentrennung und
Erboligarchie. Sie verwechselten quasi die Landkarte mit der Landschaft. Oder anders,
sie hielten das idealisierte Selbstporträt für ein authentisches Foto.
Einem Großteil der restlichen Welt,
mit und ohne Internetanschluss, waren die Ansichten der Vereinigten Staaten
nach wie vor zwar völlig egal. Leider jedoch bekam der gesamte Planet die
Auswirkungen ihrer Politik zu spüren.
Gerade noch so waren die USA die
größte Volkswirtschaft auf der Erde. Da die US-amerikanische Bevölkerung mit
rund 327 Millionen Einwohnern im Vergleich zu Europas Staaten riesig war, gab
es logischerweise auch von jeder sozialen Gruppe mehr. Alleine New York City
hatte genauso viele Einwohner wie die gesamte Republik Österreich oder das flächenzweitgrößte
deutsche Bundesland Niedersachsen. Die Gesamtheit war in sich natürlich noch
einmal mehrfach unterteilt, und wir alle wissen, dass die Schere zwischen Arm
und Reich weiter wird. Nirgends habe ich bisher so viele hochgebildete und
intelligente Frauen und Männer getroffen wie in den USA. Gleichzeitig habe ich
noch nirgends so große Teile der Bevölkerung gesehen, die keinerlei Zugang zu
Ausbildung, Krankenversorgung und Wohlstand hatten. Manche Stadtviertel und
Industrieruinen erinnerten mich an Teile des ehemaligen Ostblocks kurz nach dem
Fall des Eisernen Vorhangs, namentlich an jene Orte der ehemaligen CSSR, wo die
Roma und Sinti gelebt hatten.
Infrastruktur und öffentlicher Raum
verschiedener US-Bundesstaaten präsentierten sich uns vielerorts wie in so
genannten Entwicklungsländern oder in „gescheiterten Staaten“. In Gemeinden der
so genannten „Flyover states“ gab es
sechs oder noch viel mehr Pfarrkirchen, aber kein Museum für Naturgeschichte.
Und, OMG, das einzige Krankenhaus weit
und breit war fest in römisch-katholischer Hand. Der Skandal und Inhalt der
Empörung sollte meiner Meinung nach sein, dass außer religiösen und anderen
karitativen Organisationen und Logen sich niemand für diese Menschen
interessierte und sich um sie kümmerte. Und über diese fettleibigen,
zahnlückigen und bibelfesten Hinterwäldler durfte dann auch noch herzhaft
gelacht werden. Komisch, dass die dann Populisten wählten und einen Grant auf
die liberalen Eliten in den feinen Städten entwickelten.
Angesichts solcher Zustände fragte
ich mich oft, welche Länder Donald Trump eigentlich mit welcher Berechtigung im
Vergleich zu seinen eigenen als „shithole
country“ bezeichnete? Im eleganten Teil der Vereinigten Staaten, wo die
reichsten Menschen der Welt hervorragend lebten, bekam er von alldem natürlich
keinen Eindruck. Die Touristen in den Zentren der großen Städte New York City,
Boston, Washington DC oder Los Angeles auch nicht.
Das alles zusammen ergab eine
schiefe Optik. Jede Generalisierung war darum von vorneherein falsch. Auch,
oder gerade, weil sich aus vermehrten Ereignissen und Haltungen gewisse
Tendenzen und Muster ableiten ließen. Zum Ausgleich dieser Ungerechtigkeit wurden
Stereotypen über den jeweils anderen zu beiden Seiten des Atlantiks gehegt und
gepflegt. Die US-amerikanischen Vorurteile über Europäer sind keineswegs
freundlicher. Nur hierzulande weniger bekannt. Und bekam man sie z.B. in
Sitcoms zu Ohren, hielt sie jede und jeder wohlwollend für Satire und einen
Scherz.
Die Transatlantische Freundschaft hatte als Überseekabel für den
Datenaustausch zwischen dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Irland
und den Vereinigten Staaten von Amerika begonnen, entwickelt und quer durch den
kalten und finsteren Atlantik verlegt durch den deutschen Siemens-Konzern. Und
wenn man ganz ehrlich ist, zu nichts anderem mehr oder Wärmeren hatte sich diese
Verbundenheit seit 1874 weiterentwickelt. In den letzten Jahren war zudem eine
deutliche Abkühlung des Gesprächsklimas zu spüren gewesen.
Für den so genannten durchschnittlichen
US-Amerikaner war Europa der Kontinent der Weichlinge („sissy“), der schon sehr bald in einem moslemischen Kalifat enden
wird. Oder alternativ dazu (allerdings ungleich weniger verbreitet), im Vierten
Reich. Europäische Mädchen und Frauen waren für jeden Mann einfach zu haben.
Und europäische Bildung und akademische Lehre wurde insgesamt als „Scheiße“ („crap“) angesehen. Was für jedermann zu
gleichen Bedingungen zugänglich war, das musste Müll sein. Kurz gesagt: Die
Alte Welt war dem Untergang geweiht. Gegenwart und Zukunft gehörten den USA.
Und der Vergangenheit drückten sie im Nachhinein und nachhaltig ihren Stempel
auf.
Alle diese Stereotypen vereinten
sich in der für mich überhaupt nicht nachvollziehbaren Aufregung über die
französische Fußball-Nationalmannschaft, als dieses Team 2018 in Russland den
Weltmeistertitel gewann. Das Finale gegen Kroatien wurde von vielen, nicht nur
von white supremacists, als Menetekel betrachtet. Skurriler Weise auch von
einem kanadischen Einwanderer. Es war mir in mehreren Gesprächen nicht möglich
gewesen, mein jeweiliges Gegenüber von der Tatsache zu überzeugen, dass farbige
französische Nationalspieler durchaus Frankreich und nicht den Untergang des
Abendlandes repräsentierten. Und das erlebte ich in einer Nation, deren
Athleten in allen Sportarten jede mögliche ihrer Hautschattierungen zu Markte
trugen.
Für viele deutschsprachige
Menschen ist es bis dato unvorstellbar, dass noch weit mehr englischsprachigen
beim Gedanken an eine politische und wirtschaftliche deutsche Hegemonie der
Europäischen Union ein kalter Schauder den Rücken hinunterläuft. Für viele von
ihnen sind die deutschsprachigen Überlebenden des Zweiten Weltkriegs nicht mehr
und nicht weniger als die Nachkommen der Feinde von einst. Und für einige aus durchaus
nachvollziehbaren Gründen. Familienmitglieder fielen oder wurden während des
Holocaust ermordet. Der vielerorts geschätzte Schlussstrich und die historische
Amnesie wurden jenseits des Atlantiks nicht mitgemacht. Sieger vergaßen ihre
Triumphe nur höchst ungern. Ein deutscher Akzent war darum für eine große
Anzahl von US-Amerikanern entweder ein rotes Tuch, oder Anlass zur Erheiterung.
Natürlich niemals offen im beruflichen oder akademischen Umfeld. Dort nur
privat und hinter vorgehaltener Hand.
Direkt erfahrbar wurden diese
Vorbehalte für mich in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Warte- und Vorzimmer
meiner Ärztinnen und Therapeuten oder unterwegs als Tourist. Der Bundesstaat
Pennsylvania hatte seine deutschsprachige Vergangenheit beinahe völlig aus dem
Alltagsleben entfernt oder zu randständiger touristischer Folklore gemacht. Zum
Glück nur einige wenige Male wurden Juliane und ich offen ausgelacht,
nachgeäfft oder sogar angepöbelt. Vielen war so ein Benehmen merklich
unangenehm, da mehrheitlich großer Wert auf Höflichkeit und Respekt im Umgang
gelegt wird. Die Umstehenden versuchten sofort, den Vorfall ungeschehen zu machen.
Durch eisiges Ignorieren der Übeltäter und freundliches über das zuvor Gesagte
Hinweg-Plaudern.
Indes, in etlichen
US-amerikanischen Kino- und TV-Produktionen sprachen groteske Gestalten in der
Originalfassung sehr oft mit deutschem Akzent („The Big Lebowski“, 1998). Der Effekt ging allerdings in den meisten
deutschen Synchronisationen verloren, oder die verantwortlichen Studios ersetzten
den charaktergebenden Akzent durch einen österreichischen Dialekt („A Bug´s Life“/ „Das große Krabbeln“, 1998 und „Zootopia“/ „Zoomania“, 2016; beide:
Walt Disney Pictures). Bei anderen Figuren bzw. Antagonisten wie Mr. Freeze/
Victor Fries in dem DC-Comicfranchise Batman,
wurde der deutschsprachige Hintergrund und Akzent des Charakters nachträglich
gestrichen oder verschleiert. Arnold Schwarzenegger verkörperte 1997 den
Bösewicht noch entsprechend auf der großen Leinwand („Batman & Robin“). Das ganze Phänomen zeigte sich zuletzt
insgesamt rückläufig, wohl auch dem Umstand geschuldet, dass es sich im
deutschsprachigen Raum nach wie vor um den zweitgrößten Absatzmarkt für die
US-Unterhaltungsindustrie handelte.
Überhaupt haben das gesprochene und
auch das gegebene Wort in den USA meiner Erfahrung nach einen völlig anderen
Stellenwert als in Europa. Böse Zungen würden behaupten, keinerlei. Nichts
anderes habe ich tatsächlich in jedem Reiseführer und Ratgeber über die
Vereinigten Staaten gelesen, so dass ich glaube, dass es sich um eine
allgemeine Erfahrung handelte. Am Service-Telefon bedeutete das Versprechen,
demnächst zurückzurufen, ein bewährtes Abwimmeln unangenehmer Anrufer. Niemand
wird sich je melden. Eine Einladung zum Abendessen oder zu einem Besuch ohne
Terminvereinbarung war weder ein Versprechen, noch eine Absichtserklärung. Es
handelte sich um eine Höflichkeitsfloskel. Groß war z.B. das Entsetzen, als
eine junge Frau aus Osteuropa plötzlich wirklich bei jemandem mit ihren Koffern
vor der Türe stand, um in den USA zu bleiben. Niemand hatte sie tatsächlich
eingeladen oder ehrlich zum Einwandern ermutigt. Insgesamt festigte sich unser
Eindruck, dass es entgegen US-amerikanischer Gewohnheit war, ein Anliegen
abzulehnen, einer Bitte zu widersprechen und Unwillen oder gar Unvermögen offen
anzusprechen. Eine Bitte wurde angenommen oder eine Zusage gegeben, selbst
falls eine Umsetzung nicht möglich oder gewünscht war. Anders gesagt, alles
Vorgebrachte wurde von vornherein bejaht. Entweder um sein Gesicht zu wahren,
oder um gute Stimmung zu machen. Oder beides. Hakte jemand nach, konnte sich niemand
mehr erinnern. Und mehrmals war es uns passiert, dass eine Verabredung erst am
Treffpunkt und auf Nachfrage via Mobiltelefon abgesagt wurde, sogar bereits im
Konzertsaal an den reservierten Plätzen.
Julianes und meine baldige Abreise
provozierte großes Bedauern. Auch über den Umstand, mich nicht besser
kennengelernt zu haben. In zwei Jahren war auch wirklich kaum Zeit dazu
gewesen. Andere wieder äußerten tiefe Traurigkeit darüber, wie sehr sie uns
vermissen werden. Was mich mehr als verwunderte, da ich kaum oder gar keinen
Kontakt mit diesen Menschen hatte.
Polinnen und Polen haben
angeblich bis vor kurzem noch zu bedeutungslosem Geschwätz, leeren Versprechen
und Dampfplauderei „österreichisch geredet“ gesagt. Ich würde heute für eine
Änderung der Wendung in „amerikanisch geredet“ plädieren.
Auch die Politik funktionierte
mehr und mehr nach dem „sola figura“-Prinzip. Das Erscheinungsbild des Redners und
der Unterhaltungsgrad seiner Worte ersetzten den Inhalt. Sympathiewerte
bestimmten den Grad der Glaubwürdigkeit. Nach welchen Kriterien Sympathie,
Glauben und Zuneigung verteilt wurden, war und ist mir allerdings schleierhaft.
Flüchtlinge, Arme und Behinderte wurden als leistungsscheu und privilegiert
angefeindet, wogegen Personen, die tagein und tagaus Fotos von sich beim
Golfen, Schminken und Sonnenbaden am Pool posteten, zigtausende Follower in den
Sozialen Medien um sich scharten. Und Kunstformen, die laut und deutlich
Sexismus, Habgier und Gewalt verherrlichten, zum Mainstream verklärt wurden.
So gewann ich den Eindruck, dass
weniger bedeutsam war, was jemand sagte, sondern wer etwas sagte. Größere
Bedeutung als dem klar und vernehmlich ausgesprochenen Wort wurde Abstammung
und Geschlecht der Autoren zugemessen. In der öffentlichen Diskussion stand
eher im Vordergrund, ob z.B. ein weißer alter Mann oder eine junge farbige Frau
ein Thema aus- bzw. angesprochen hatte. Wie vieles war auch das nicht so einfach
wie es sich zunächst darstellte. Aber allzu leicht konnte auch dieses
Problemfeld von den üblichen Verdächtigen vereinfacht und instrumentalisiert
werden. Für die Republikaner waren die antisemitischen Aussagen der demokratischen
Politikerin und Abgeordneten im Repräsentantenhaus Ilhan Abdullahi Omar (MN) ein
willkommener Anlass. Besonders vor dem Hintergrund der eigenen Skandale, z.B.
um den Senator Tommy Norment (VA) und das rassistische „black facing“.
Die ganze Sache gestaltete sich
besonders schwierig, sobald es parteiintern unter Demokraten zu ganz ähnlichen Reibereien
kam, sobald es um mögliche Präsidentschaftskandidaten für die Wahl 2020 gegen
Donald Trump ging. Angesichts dieses „divide et impera“ kann der amtierende
US-Präsident leicht auf die Kandidatur von Joe Biden antworten, dass dieser
eine größere Gefahr für sich selbst als für ihn darstellt: „Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a
successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people
who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will
see you at the Starting Gate!” [5:22 AM - 25 Apr 2019, @realDonaldTrump]
Auf die Frage, was ich selbst am
meisten von New Haven vermissen werde, musste ich wahrheitsgemäß antworten,
dass es die Musik sein wird. Die zahlreichen Freundschaften und tiefgründigen
Gespräche werden es nicht sein. Die wahrhaft geschlossenen Beziehungen konnte
ich an einer Hand abzählen. Nichtsdestotrotz konnte ich auch diese Erfahrung
machen. Ich habe durchaus auch Menschen getroffen, deren Ja ein Ja und deren
Nein ein Nein gewesen war. Aber Hatty, meine Krankenschwester, versicherte mir,
dass diese geringe Anzahl auch für ein ganzes Leben in Connecticut ein guter
Schnitt wäre und nicht nur für zwei Jahre. Bis auf ein paar wenige, führte ich
die längsten und offensten Gespräche mit Menschen, die dafür bezahlt wurden
(entweder von mir oder meiner Krankenversicherung). Also, mit Ärzten und
Therapeuten. Viele Menschen, denen ich in Yale und an anderen Unis begegnete,
beschränkten sich darauf, abzuchecken, welche Rolle ich in ihrer Karriere
einnehmen konnte, oder halt nicht. Und beim Versuch, nichts zu äußern, was
nicht von der Mehrheit akzeptiert und geteilt wurde, oder was sie dachten, das
ich nicht hören wollte bzw. sollte, sagten sie gar nichts von Belang. Oder
wirklich nichts.
Bevor ein Gedanke in Gesellschaft
geäußert wurde, der keine breite Akzeptanz versprach oder sonst von niemanden
geteilt wurde und darum zum Bumerang werden konnte, wurde er verschwiegen. Das
ließ so manche Europäerin die erwartete intellektuelle Neugier vermissen. Es
hinterließ bei sozialem Kontakt sehr oft dasselbe Gefühl wie ein Familienessen,
dessen Teilnehmer ein Leben lang nichts Persönliches von sich preisgegeben
hatten und somit keiner irgendwem etwas zu sagen hatte. Im Leben der Anderen
spielte keiner der Anwesenden eine Rolle. Die alten Anekdoten waren sattsam
bekannt, neue Gemeinsamkeiten kamen nicht dazu. Der Rest war betretenes
Schweigen. Sogar Konversationsratgeber – ich hatte einen erworben und gelesen,
um in Zukunft Fehler auf Partys, bei Besuchen und Empfängen zu vermeiden –,
rieten, sich nur dort aufzuhalten, wo
gelacht wurde und die Sonne schien. Das bedeutete, Sonderlinge und
Langweiler im Schatten ihrer trüben Wolke stehenzulassen. Es sei denn, es
handelte sich bei ihnen um Vorgesetzte und potentielle Unterstützer, dann
konnte das eisige Ausgrenzen rasch in speichelleckerischen Konformismus
umkippen. In Zeiten jeder möglichen politischen und religiösen Radikalisierung
und feuerbewaffneter Amokläufe beurteilte ich solches Verhalten als keine
zukunftsreiche Strategie.
Umgekehrt, die schönen und
angenehmen Erlebnisse sollte jede und jeder mit seinem engsten Freundeskreis
verbringen. Wo dieser angetroffen werden sollte, wo niemand irgendwo irgendetwas
von sich preisgab, ist mir bis dato ein Rätsel. Erschwerend hinzu kam, dass
sogar Frauen und Männer, die ihr Leben dem Lesen zwischen den Zeilen der
Literatur und dem Deuten der Nuancen der Philosophie gewidmet hatten, jedes
Buch ohne zu Zögern nach dem Einband beurteilten. Das heißt, alle Menschen nach
ihrem oberflächlichen Erscheinen bewerteten und etikettierten. Getreu dem
Grundsatz: Bist du Freund oder Feind?
Wen wunderte es also, dass meine
Therapeutin jeden Stundenschlag ihres Arbeitstags eine oder einen Yalie auf der
Couch liegen bzw. im Polstersessel sitzen hatte. Auch die allerjüngsten, ihre
Töchter und Söhne im Vorschulalter. Alle litten unter Erfolgsdruck, Konkurrenz
und am allerschlimmsten unter Einsamkeit. Von den im Abwasser aufgelösten
Antidepressiva schwebten die örtlichen Kanalratten gewiss auf Wolke sieben. Um
vom Cannabis high zu werden, reichte an manchen Tagen das tiefe einatmen vor
geöffneten Fenstern von Wohnungen aber vor allem von geparkten Autos.
Nach einer Verallgemeinerung über
die von Populisten angefeindete so genannte liberale Elite der USA gefragt,
würde ich antworten, dass sie just den Fehler begangen hat, vor dem bereits
Voltaire vor mehreren hundert Jahren eindringlich gewarnt hatte. Der
französische Philosoph der Aufklärung war überzeugt, dass es keinen Gott gab,
dass man dieses Wissen aber niemals seinem Diener mitteilen dürfe, weil einen dieser
sonst im Schlaf erwürgen würde. Anders gesagt, all die Eiferer, die in aller
Bequemlichkeit ihrer Herkunft über die soziale Revolution und Dekonstruktion
aller Werte faselten, übersahen, dass sie selbst in den Augen einer wachsenden
Mehrheit die Privilegierten waren, von denen sie den „einfachen Mann“ befreien
wollten. Welche Hochnäsigkeit. Und zugleich, welche Gefahr, trug diese offen
zur Schau gestellte Haltung doch maßgeblich dazu bei, die Schwellenangst
abzutragen, die jahrhundertelang ihren elitären Status geschützt und erhalten
hatte.
Was genau meine ich damit? Gab es
keinerlei Legitimation für Hierarchie und Regierung mehr außer Gewalt und Geld,
nach welchen Maßstäben sollte sich eine Gesellschaft in Zukunft organisieren?
Wonach sollten die Unterdrückten streben? Zugang zu Bildung und zu sozialem
Aufstieg hatten sie nicht. Wovon gingen also die Münder der Populärkultur über
(vor allem in der Hip hop music),
womit waren die Herzen voll? Mit Geld, Sexismus und Gewalt. Und wessen Schuld
war das? Meiner Meinung nach war es die Verantwortung jener, die bisher alle
anderen, auch die jahrhundertelang kulturell gewachsenen Inhalte entwertet
hatten. Gleichzeitig aber durch sie angenehm gelebt hatten. Jedwede Glaubwürdigkeit
ging somit verloren. Und mit ihr der Glaube an die Zukunft.
Dieser düstere Ausblick bildete
jedoch nicht mein Fazit. Das lautete bei aller Kritik zum Glück anders und weit
positiver. Und ich bin dabei nach wie vor meiner Herkunft und Erziehung verpflichtet:
Ich bin überzeugt, dass wenn es
zukünftigen Generationen gelingen könnte, alle Vorteile und Errungenschaften
von beiden Seiten des Atlantiks zu einer Gesellschaftsform zu vereinen –
Demokratie, Wohlstand, Sozialstaat, Medizin und Wissenschaft –, dann wäre diese
Gemeinschaft zwar immer noch nicht der Himmel auf Erden, aber ein glücklicherer
Ort für alle.
E pluribus unum!